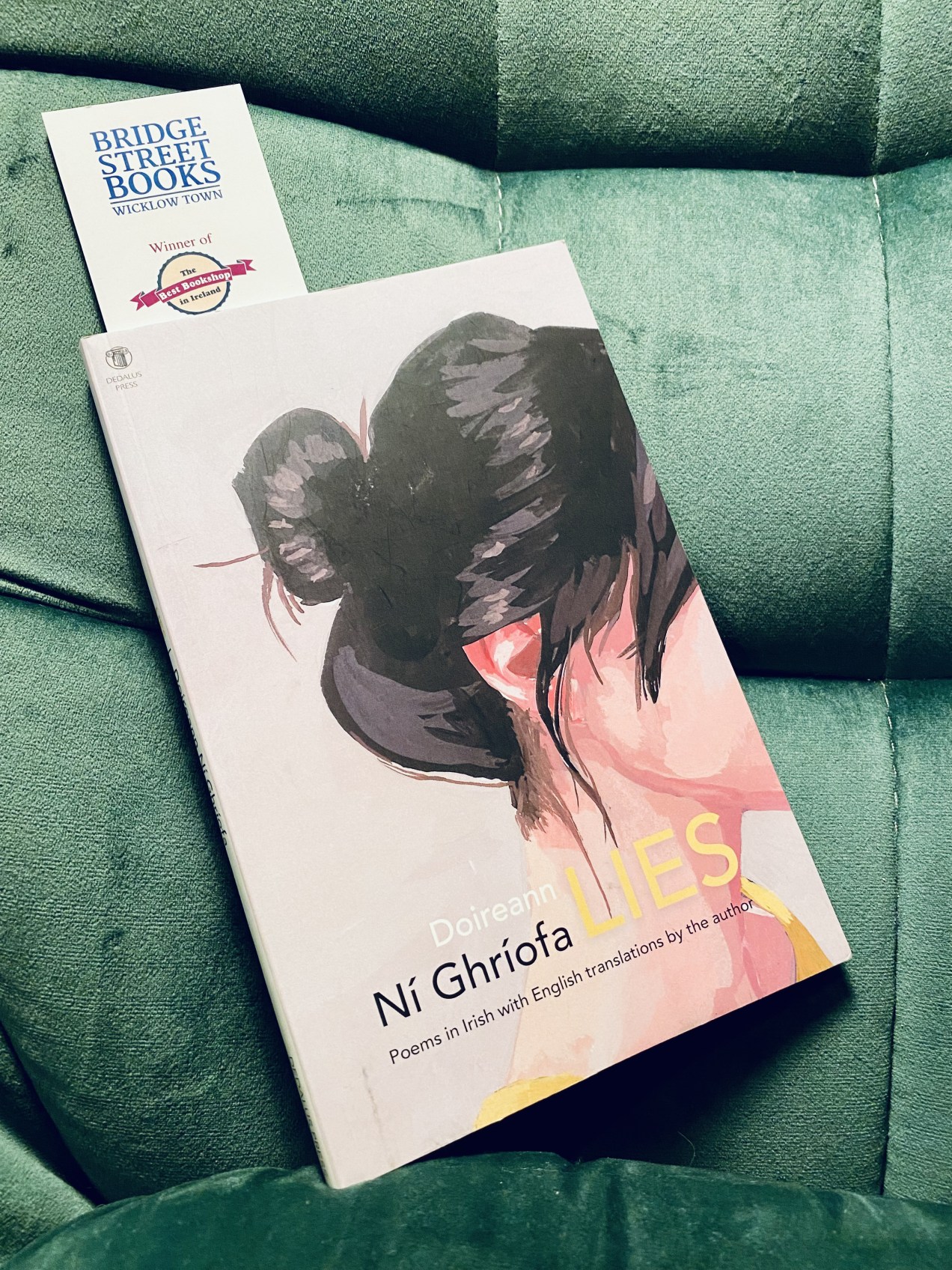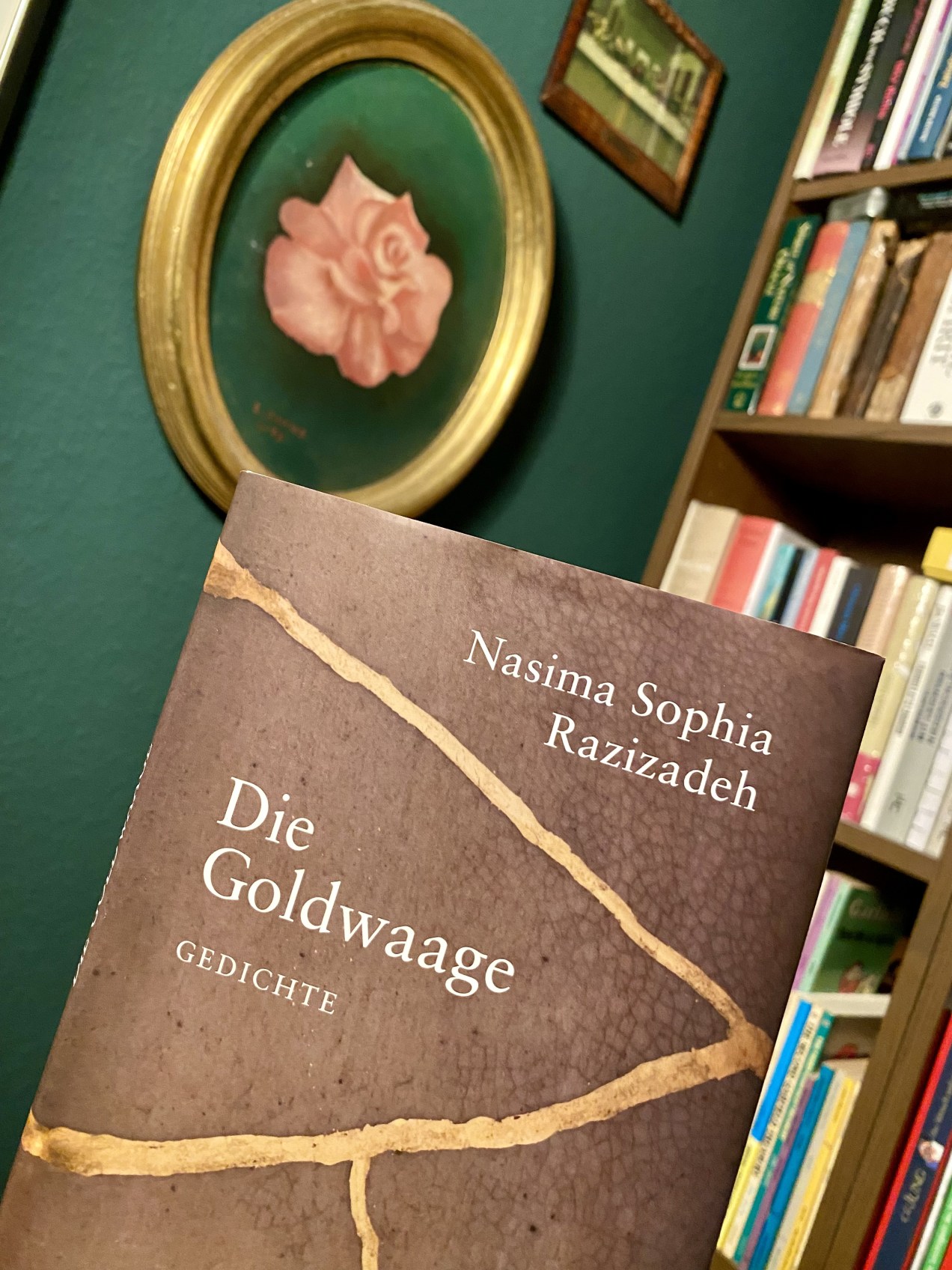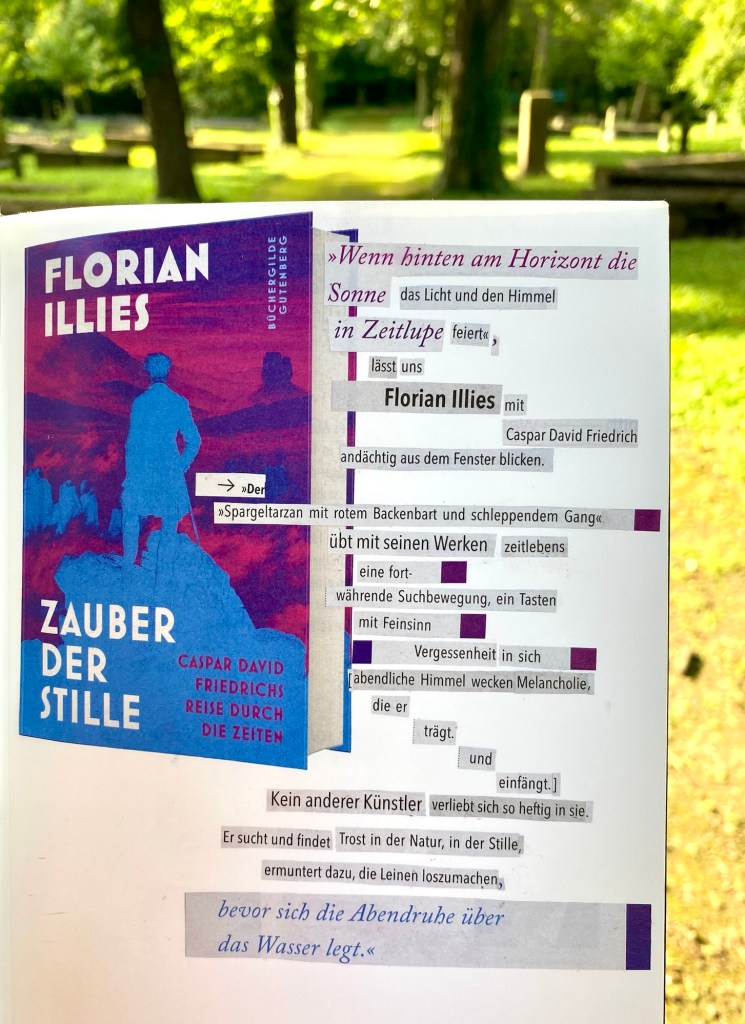Gyrðir Elíasson (übersetzt von Jón Thor Gíslason und Wolfgang Schiffer), Die Sprache der Möwen, Elif Verlag
Im August machte ich den mir aus einer gemeinsamen Lesung bekannten Dichter und Übersetzer isländischer Lyrik, Wolfgang Schiffer, auf ein Konzert des mir lieb gewordenen Sängers Svavar Knútur aufmerksam. Seine freundliche Antwort enthielt ein großzügiges Angebot: Er wolle mir den im Oktober auf Deutsch erscheinenden Gedichtband „Die Sprache der Möwen“ von Gyrðir Elíasson zusenden.
Angesichts eines privat stürmischen Sommers fanden die Möwen zunächst keinen Weg zu meinem Ohr, sondern bauten sich ein Nest im Hinterkopf – und drängen nun auf Resonanz in meinen Tasten.
Veröffentlichungen des Elif Verlags finden ohnehin leicht ihren Widerhall bei mir. Der Hinweis, dass die Möwensprache Gedichte aus Bänden mit den Titeln Geheimer Stern und Während das Glas schläft vereint, weckt sofort Neugier. Schon der Einband – geometrische Figuren auf einem Aquarell – verspricht Klarheit und Weite.
Beim Aufschlagen freue ich mich: die Gedichte sind zweisprachig abgedruckt. Auch wenn isländische Möwen bei mir auf verständnislose Ohren stoßen, liegt in der Präsenz der Ursprungssprache Zärtlichkeit.
Das Inhaltsverzeichnis überzeugt mit seiner liebevollen Systematik: dreistellige Seitenzahlen, sechs Kapitel, dazu die Herkunftsbände der Gedichte in Klammern. Hier wird deutlich – dieser Band ist mehr als eine bloße Zusammenstellung, eher eine neu komponierte Setlist mit eigenen Kapitelüberschriften. Wie der Einband schon andeutet: eine Balance aus Spiel und Ordnung.
Erneute Freude, als ich erkenne: Elíasson ist ein Freund der kurzen Form – schließlich trällern auch Möwen keine Arien.
Wir beginnen mit Kapitel eins: „Noch ein Frühling“ – ein Loop aus Neubeginn und Vergänglichkeit.
In „Ein paar Worte über natürliche Schönheit“ wird
„Schönheit in zertretenem
und abgestorbenem Gras“
so zärtlich gefeiert, dass sie alles erlaubt,
„was der Tag sonst noch
mit sich bringen mag“.
Diese Offenheit durchzieht den Band. Wenn es heißt:
„hat er nie
um etwas gebeten
(nur gewartet)
doch jetzt bittet er
Dass alles weitergehen möge“
wird Hoffnung zum stillen Gebet um mehr Tage, von denen an späterer Stelle zugleich nichts mehr erwartet wird, selbst die Sonne „meinetwegen verschwinden“ kann.
In der „Regenzeit“ tauchen ufernahe Grashalme zuerst unter,
„Sie schwanken
wie ein zerrissener Fächer
im Strom“.
Die Natur ist nicht bloß Kulisse, sie spricht – wie in „Der Schwimmvogel“, wo dem rauschenden Bach pflanzlicher Rat erteilt wird:
„ein paar Vogelbeeren vor der Hauswand
wackeln mit ihren Blättern,
als wollten sie ihm sagen,
er solle langsamer machen“.
„Die Wanderung“ offenbart eine Spannung, in der zunächst zart anmutende Nähe banal und dann wiederum Trost im Angesicht drohenden Abgrunds wird:
„Die Häuser schmiegen sich aneinander
zu einem Haufen am Strand, unter
steilen Bergen, die bereit zu sein
scheinen, sich ins Meer zu stürzen“
Natur wütet allzu menschlich, nordischen Gottheiten gleich. So ist der Fluss
„Rostbraun
und wild, er erinnert
an einen Säufer,
der einen Wutanfall
bekommen hat, weil
es keinen Alkohol mehr gibt.“
Mal schweigen die Vögel wie Stein, was resignativ hingenommen wird. Dann wiederum begegnet der Dichter einem allverstehenden Meer.
Im zweiten Kapitel zieht „Über den Hügeln der Wind“ etwas schärfer am oft schlaflosen Ton:
„und sie stürzen auf mich zu,
dort wo ich wehr-
los warte im dunklen Tal
ohne jegliches Grün“
Mal sitzt das lyrische Ich in einem Maulwurf, der nie aufschaute
„aus dem Keller,
den er selbst gegraben
hatte“,
mal verdingt es sich
„sowohl
als Vogel als auch als Herbstwind (…)
möchte immer wieder hierher
zurück, um vielleicht ein Baum
zu werden, für ein oder zwei Jahre
als Vertretung“.
Das dritte Kapitel, „Gästebuch zur Nacht“, öffnet dunklere Räume. „Die Flut“ spült eine fast physische Finsternis derart um sich greifend heran, dass es der Sonne nicht gelingt,
„in dieser zähflüssigen Dicke
ein Feuer zu entfachen
und bald ist auch sie
in der Masse verschwunden“.
Elíasson fürchtet die Finsternis nicht, konstatiert:
„Sogar die Albträume
sind den Schlaf wert“
und verweist auf das Ungesehene, das der Stern eines verstorbenen Dichters sein kann oder als Ungeheuer dunkler Fischgründe „Bisspuren am Luftschlauch“ hinterlassen und „dringende Fragen aufgeworfen“ hat.
Im vierten Abschnitt wendet sich „Der Freund der Gräser“ dem Humor zu, indem der universelle Schmerz des Lebens projektiv auch einem Spatz Liebeskummer beschert, mit diebischer Freude „alle Rasenmäher funktionsunfähig“ gemacht werden oder Schopenhauer das Unglück durch sein Flötenspiel zähmen lässt.
Zwischen surrealer Leichtigkeit und bitterer Erkenntnis entlarvt Elíasson die Paradoxien menschlicher Beziehungen. Ein Phönix wird zu aus Schornsteinen in den blauen Himmel gespucktem Ruß oder eine Geliebte kommt im Traum eines anderen Mannes an. Direkte Dialoge halten Einzug in die Zeilen:
„ „Menschen sterben nicht immer
in der richtigen Reihenfolge“, sagte er
mit ernster Miene, als wir
den Weg zum Krankenhaus einschlugen.“
„Das Haus im Tal“ (5. Kapitel) zwischen Erinnern und Vergessen, erscheint eng:
„Das Balkongeländer bleibt
mir auch immer im Kopf, mit
Gitterstäben, die an ein Gefängnis
erinnern“.
Im abschließenden Kapitel „Trollteig“ dann wird es fantastisch: Zeitreisen, Sternentennis, schwarze Sonnenflügel, die hier und da Federn lassen.
Und der Weltuntergang wird zur beruhigend gleichmachenden Vorstellung:
„wenn wir gehen, gehen
alle anderen ebenfalls. Das
ist der Lemming in uns,
der so groß ist wie
unsere Herzen“.
Gyrðir Elíasson hypnotisiert in kurzen Sequenzen. Seine Gedichte sind still, aber durchlässig für alles Lebendige. Sie atmen nordische Melancholie und die Disziplin fernöstlicher Formen und bilden einen ganz eigenen Ton sachlicher Romantik. Dank der feinfühligen Übersetzung Jón Thor Gíslasons und Wolfgang Schiffers klingt dieser auch im Deutschen durch.